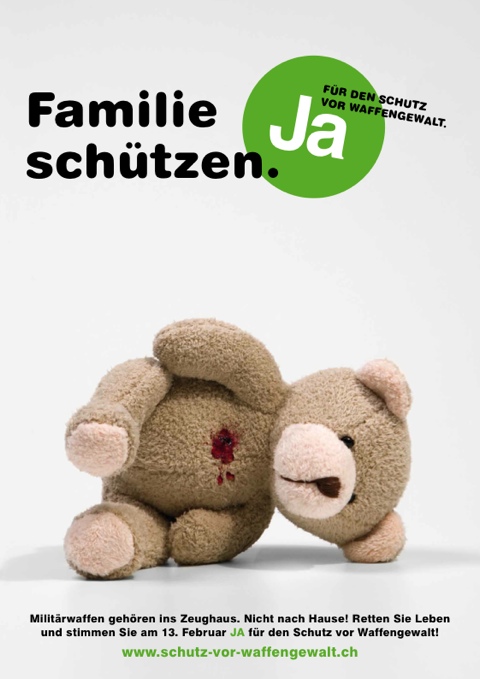Das Denkmal der Arbeit
|
|
Längst nicht alle sind glücklich mit Geisers Darstellung der Arbeiterklasse. Die Gewerkschaften vermissen das Pathos, die Grösse und die Kraft der Gestalten. Der Schweizerische Bau- und Holzarbeiter-Verband (heute Teil der Unia) stellt 90'000 Franken für ein gigantisches Gegenprojekt bereit: Der Bildhauer Werner F. Kunz soll heimlich einen fesselsprengenden Arbeiter in monumentaler Höhe aufbauen, der fertig gegossen der Stadt Zürich geschenkt werden soll. Doch der Stadtrat bekommt Wind von diesem Vorhaben — und die pathetische Plastik verschwindet für einige Zeit im Depot der Stadt, bis sie schliesslich 1962 auf dem Werdplatz vor dem damaligen Restaurant Cooperativo aufgestellt wird.
Auch als die beiden konkurrierenden Arbeiterdenkmäler bereits stehen, gehen die Kontroversen weiter: Bei Geisers Figurerngruppe wirft das "Magazin" 1975 die Frage auf, ob es sich nicht eher um ein Denkmal des Arbeitsfriedens handle als um eines der Arbeit. Dass es Arbeiter seien, sei zu wenig gut erkennbar, es könne sich auch um eine Familie auf dem Weg zur Migros handeln. Die Figur vor dem "Coopi" andererseits wird despektierlich als "Stachanow" oder "Kraftprotz" tituliert. In den 90er Jahren bringen radikale Feministinnen mehrmals Verzierungen an dem "Kerl" an, den sie als Ärgernis empfinden.
Anzumerken bleibt noch, dass die Grossbronze von Werner F. Kunz ursprünglich gar nicht als Arbeiter gedacht war. Sie sollte das marode Patriotendenkmal in Stäfa ersetzen. Dieses Denkmal erinnert an die Freiheitskämpfer im Stäfner Handel von 1795, die sich gegen die Bevormundung durch die Stadt Zürich wehrten.
Quellen:
Jan Morgenthaler (1988): Der Mann mit der Hand im Auge. Die Lebensgeschichte von Karl Geiser. Limmat Verlag, Zürich.
Martin Huber (2008): Wie die Arbeiter auf den Sockel kamen. Tagesanzeiger online, 26.4.2008.



 Im öffentlich ausgeschriebenen Ideenwettbewerb hat dieser Vorschlag von Felix Kuhn das Rennen gemacht. Von den 12 anonym eingereichten Arbeiten hat der "Klotz", ein Würfel aus Beton, Metall und Glas mit einer Kantenlänge von 6 Metern, 500 Tonnen schwer und 140'000 Franken teuer, die neunköpfige Jury als "künstlerische Intervention" mit ihrem "mutigen subtil-subversiven Ansatz" am meisten überzeugt. Das Werk thematisiert den Wert von Kunst im öffentlichen Raum: Das Volumen des Würfels (216 Kubikmeter) steht im gleichen Verhältnis zum Total des auf der Allmend verbauten Materials (400'000 Kubikmeter) wie die Kosten für den "Klotz" zu den 250 Millionen Franken, die für die neuen Bauten auf der Luzerner Allmend aufgewendet werden: 0.00056 zu 1. Auch die Zusammensetzung des Würfels entspricht den für die Neubauten verwendeten Materialien.
Im öffentlich ausgeschriebenen Ideenwettbewerb hat dieser Vorschlag von Felix Kuhn das Rennen gemacht. Von den 12 anonym eingereichten Arbeiten hat der "Klotz", ein Würfel aus Beton, Metall und Glas mit einer Kantenlänge von 6 Metern, 500 Tonnen schwer und 140'000 Franken teuer, die neunköpfige Jury als "künstlerische Intervention" mit ihrem "mutigen subtil-subversiven Ansatz" am meisten überzeugt. Das Werk thematisiert den Wert von Kunst im öffentlichen Raum: Das Volumen des Würfels (216 Kubikmeter) steht im gleichen Verhältnis zum Total des auf der Allmend verbauten Materials (400'000 Kubikmeter) wie die Kosten für den "Klotz" zu den 250 Millionen Franken, die für die neuen Bauten auf der Luzerner Allmend aufgewendet werden: 0.00056 zu 1. Auch die Zusammensetzung des Würfels entspricht den für die Neubauten verwendeten Materialien.