Emmi gut — alles gut?
Am 5. April habe ich über ein drohendes Kulturpolitisches Déja-vu geschrieben — kommt es jetzt zu einem Happy End?
Wie das Regionaljournal Zentralschweiz von Radio DRS berichtet, wurde an einem runden Tisch eine Einigung im Streit um das Bauprojekt vom Emmi erzielt. Die BetreiberInnen der betroffenen Kulturbetriebe Treibhaus und Theaterpavillon, die gegen das Bauprojekt rekurriert haben, haben sich mit dem Milchverarbeiter Emmi und der Stadt Luzern an einen Tisch gesetzt und gemeinsam mit einem Mediator Lösungen erarbeitet.
 Die Butterzentrale spiegelt sich im 2008 eröffneten Theaterpavillon — gefährden die geplanten Wohnbauten den neuen Kulturbetrieb oder ist mit der erzielten Einigung alles wieder in Butter? (Bild: Theaterpavillon auf Google+)
Die Butterzentrale spiegelt sich im 2008 eröffneten Theaterpavillon — gefährden die geplanten Wohnbauten den neuen Kulturbetrieb oder ist mit der erzielten Einigung alles wieder in Butter? (Bild: Theaterpavillon auf Google+)
Herausgekommen ist ein Dienstbarkeitsvertrag, der die künftigen BewohnerInnen der Emmi-Überbauung verpflichtet, die Lärmimmissionen der benachbarten Kulturbriebe zu dulden, so lange sie den gesetzlichen Rahmen nicht überschreiten. In einer zusätzlichen Vereinbarung verpflichtet sich Emmi zu baulichen Massnahmen, um die Immissionen minimieren, und die Stadt hilft den beiden Kulturbetrieben, Ruhe und Ordnung einzuhalten. Sollte es dennoch zu Lärmklagen kommen, müssten sich die KlägerInnen zuerst an eine Schlichtungsstelle, dann an ein gemeinsamen runden Tisch wenden. Im Gegenzug für diese Einigung haben die beiden Kulturbetriebe ihre Rekurse gegen das Emmi-Projekt zurückgezogen. Gestern bewilligte die Stadt das Bauprojekt.
Es herrscht also wieder Friede, Freude, Eierkuchen, aber ob alles wieder in Butter ist, wird sich in der Praxis erst noch zeigen müssen, denn Konflikte um nächtlichen Menschenverhaltenslärm sind vorprogrammiert.
Wie das Regionaljournal Zentralschweiz von Radio DRS berichtet, wurde an einem runden Tisch eine Einigung im Streit um das Bauprojekt vom Emmi erzielt. Die BetreiberInnen der betroffenen Kulturbetriebe Treibhaus und Theaterpavillon, die gegen das Bauprojekt rekurriert haben, haben sich mit dem Milchverarbeiter Emmi und der Stadt Luzern an einen Tisch gesetzt und gemeinsam mit einem Mediator Lösungen erarbeitet.
 Die Butterzentrale spiegelt sich im 2008 eröffneten Theaterpavillon — gefährden die geplanten Wohnbauten den neuen Kulturbetrieb oder ist mit der erzielten Einigung alles wieder in Butter? (Bild: Theaterpavillon auf Google+)
Die Butterzentrale spiegelt sich im 2008 eröffneten Theaterpavillon — gefährden die geplanten Wohnbauten den neuen Kulturbetrieb oder ist mit der erzielten Einigung alles wieder in Butter? (Bild: Theaterpavillon auf Google+)Herausgekommen ist ein Dienstbarkeitsvertrag, der die künftigen BewohnerInnen der Emmi-Überbauung verpflichtet, die Lärmimmissionen der benachbarten Kulturbriebe zu dulden, so lange sie den gesetzlichen Rahmen nicht überschreiten. In einer zusätzlichen Vereinbarung verpflichtet sich Emmi zu baulichen Massnahmen, um die Immissionen minimieren, und die Stadt hilft den beiden Kulturbetrieben, Ruhe und Ordnung einzuhalten. Sollte es dennoch zu Lärmklagen kommen, müssten sich die KlägerInnen zuerst an eine Schlichtungsstelle, dann an ein gemeinsamen runden Tisch wenden. Im Gegenzug für diese Einigung haben die beiden Kulturbetriebe ihre Rekurse gegen das Emmi-Projekt zurückgezogen. Gestern bewilligte die Stadt das Bauprojekt.
Es herrscht also wieder Friede, Freude, Eierkuchen, aber ob alles wieder in Butter ist, wird sich in der Praxis erst noch zeigen müssen, denn Konflikte um nächtlichen Menschenverhaltenslärm sind vorprogrammiert.
Kulturflaneur - 29. Sep, 17:59



 "Perennial Affairs", Einzelausstellung des Amerikaners Hernan Bas, 11.6. - 30.7.2011, Quelle:
"Perennial Affairs", Einzelausstellung des Amerikaners Hernan Bas, 11.6. - 30.7.2011, Quelle: 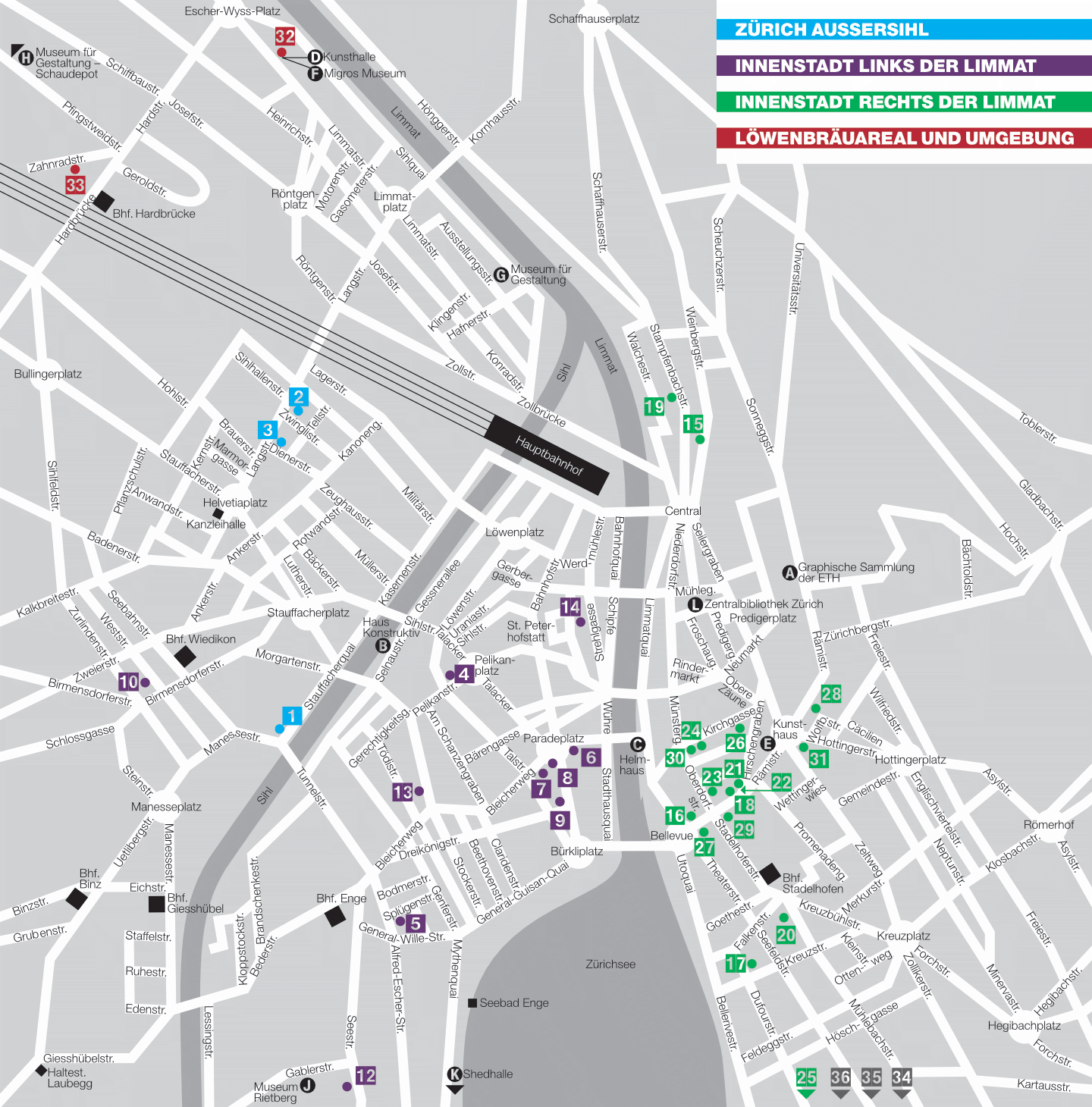 Quelle:
Quelle: 


 4 Alpkäsedegustation
4 Alpkäsedegustation 5 Keine Alp ohne Bähnli
5 Keine Alp ohne Bähnli





 Immer wieder schön ist die Farbenpracht der Alpenblumen am Wegrand.
Immer wieder schön ist die Farbenpracht der Alpenblumen am Wegrand.






 Die Idee ist simpel, aber gut: Man wandert durch bedrohte Natur- und Kulturlandschaften, liest über die geplanten Projekte (Stauseen, Atom-Endlager, Autobahnen, Skizirkusse etc.), stellt sich die Eingriffe in die Landschaft vor und hilft allenfalls mit, die geplanten Projekte zu verhindern. Ein Teil der umstrittenen Projekte wurde in der Zwischenzeit realisiert, ein weiterer Teil ist am Widerstand gescheitert und ein letzter Teil ist noch immer in Diskussion und noch nicht definitiv vom Tisch. Bei diesen Projekten ist es interessant, die Diskussion von damals mit dem heutigen Stand zu vergleichen.
Die Idee ist simpel, aber gut: Man wandert durch bedrohte Natur- und Kulturlandschaften, liest über die geplanten Projekte (Stauseen, Atom-Endlager, Autobahnen, Skizirkusse etc.), stellt sich die Eingriffe in die Landschaft vor und hilft allenfalls mit, die geplanten Projekte zu verhindern. Ein Teil der umstrittenen Projekte wurde in der Zwischenzeit realisiert, ein weiterer Teil ist am Widerstand gescheitert und ein letzter Teil ist noch immer in Diskussion und noch nicht definitiv vom Tisch. Bei diesen Projekten ist es interessant, die Diskussion von damals mit dem heutigen Stand zu vergleichen. Das Bild zeigt im Vordergrund den Wellenberg, in welchem der radioaktive Güsel entsorgt werden soll, und im Hintergrund die Lücke, über die wir ins Urnerland wanderten. Quelle des Bilds:
Das Bild zeigt im Vordergrund den Wellenberg, in welchem der radioaktive Güsel entsorgt werden soll, und im Hintergrund die Lücke, über die wir ins Urnerland wanderten. Quelle des Bilds: 
 Unsere Reiseroute in der Südtürkei — zur interaktiven Karte aufs Bild klicken!
Unsere Reiseroute in der Südtürkei — zur interaktiven Karte aufs Bild klicken!