Als wir vor zwei Wochen kurzentschlossen zu einer Wanderung im innovativen Bähnliland Nidwalden aufbrachen, stand für uns von Anfang an fest, dass eine Wanderung in einer so bergbahnverrückten Gegend nur von Bergstation zu Bergstation führen kann: von der Klewenalp nach Niederrickenbach.
Bei schönstem Wetter war schon die Anreise traumhaft:



Von Luzern per Schiff auf dem Vierwaldstättersee nach Beckenried und von da mit der Luftseilbahn auf die Klewenalp.
Für einmal habe ich das obligate Panorama schon vor Beginn der Wanderung aufgenommen — die Aussicht auf der Plattform neben der Bergstation der Klewenalpbahn ist wirklich spektakulär:
 Zum Vergrössern aufs Bild klicken! Zu sehen sind von links nach rechts: die Bergstation, der Bürgenstock (hinter den Seilen der Bahn), der Vierwaldstättersee (zuhinterst: das Küssnachter Becken), die Rigi, links der grossen Tanne Gersau und rechts Brunnen, der Talkessel von Schwyz und die Mythen, ganz rechts schliesslich das Berggasthaus Klewenalp.
Zum Vergrössern aufs Bild klicken! Zu sehen sind von links nach rechts: die Bergstation, der Bürgenstock (hinter den Seilen der Bahn), der Vierwaldstättersee (zuhinterst: das Küssnachter Becken), die Rigi, links der grossen Tanne Gersau und rechts Brunnen, der Talkessel von Schwyz und die Mythen, ganz rechts schliesslich das Berggasthaus Klewenalp.
Hier die Route unserer Wanderung von der Klewenalp nach Niederrickenbach:
 Zum Vergrössern auf die Karte klicken! Gestrichelt: Direktere Route mit wenig Höhendifferenzen (war wegen Schnee noch zu). Quelle der Karte: map.geo.admin.ch
Zum Vergrössern auf die Karte klicken! Gestrichelt: Direktere Route mit wenig Höhendifferenzen (war wegen Schnee noch zu). Quelle der Karte: map.geo.admin.ch
1 Putzige Kerle auf der Klewenalp

Diese Murmeltiere in einem kleinen Gehege auf der Klewenalp haben für meinen Geschmack zu wenig Platz — das schien sie aber nicht zu stören, sie waren im Gegenteil gut gelaunt und äusserst spielfreudig.
2 Wanderautobahn

Dieser Weg ist Teil einer familientauglichen Rundwanderung auf der Klewenalp — eine richtige Wanderautobahn!
3 Die Klewenalp ist auch ein Skigebiet

Die Wintersportinfrastruktur wird immer futuristischer...

Auf dem kleinen Sattel verzweigen sich die verschiedenen Wanderrouten: Von der Klewenalp kommend geht es nach links das Tal, das im Bild zu sehen ist, hinunter zur Stockhütte (Seilbahn nach Emmetten), nach rechts hangparallel nach Bärenfallen und weiter nach Niederrickenbach (gestrichelte Route) oder halbrechts hangaufwärts übers Sätteli zum Brisenhaus des SAC (Ausgangspunkt für etliche Bergtouren) — diesmal wegen Schnee auch unsere Route.
4 Alpine Soundscape

Das Bähnliland ist katholisch und auf jeder Alp steht ein solches Kreuz.
Obwohl die Alp noch nicht bestossen war, waren von weiter unten Kuhglocken zu hören, was mich auf eine Geschichte bringt, die ich auf einer früheren Wanderung von der Klewenalp nach Niederrickenbach erlebt habe: Ich war unterwegs mit Frau Froggs Freunden aus England. Irgendwann blieben die beiden ganz erstaunt stehen und sagten, dass man auch in England über Kuhweiden wandern könne, doch im Unterschied zu hier sei es da ganz still, weil die Kühe in England keine Glocken tragen. Dem englischen Paar hat die Soundscape auf der Klewenalp sehr gefallen.
5 Brisenhaus — Ausgangspunkt für Bergtouren

Das Brisenhaus (1753 m ü. M.) gehört der SAC-Sektion Pilatus
Vom
Brisenhaus, das Bergbeiz und Ausgangspunkt für etliche Bergtouren ist, führte unser Weg relativ steil den Hang hinunter ins Tal und auf der anderen Talseite dem Hang entlang nach Niederrickenbach.
6 Enzian und Pusteblumen




Wo der Schnee erst grad weg war, blühten Soldanellen. Während weiter oben erste Enziane am Wegrand waren, war der Löwenzahn hier unten im Tal schon verblüht und die ganze Wiese voll von Pusteblumen.
Prächtig und immer wieder faszinierend, diese Alpenfauna!
7 Bergkloster Niederrickenbach

Nach etwa drei Stunden reiner Wanderzeit erreichten wir das hoch über dem Engelberger Haupttal gelegene Niederrickenbach (im Hintergrund: Stanserhorn und Pilatus).

Der Blick zurück auf prächtige Heuwiesen und die Nidwaldner Berge...

...und vorwärts auf die Klosteranlage von Niederrickenbach.
Rückfahrt und ein Hinweis
Von Niederrickenbach ging's mit einer kleinen, aber feinen Seilbahn wieder ins Tal runter nach Dallenwil und mit der Zentralbahn zurück nach Luzern:


Eine schöne Fahrt, allerdings waren wir nicht die einzigen, die das schöne Wetter in den Bergen genossen hatten und nun im Zug sassen...
Ein Hinweis: Mit diesem Eintrag verabschiede ich mich in die Ferien. Wir fahren ins Tessin.

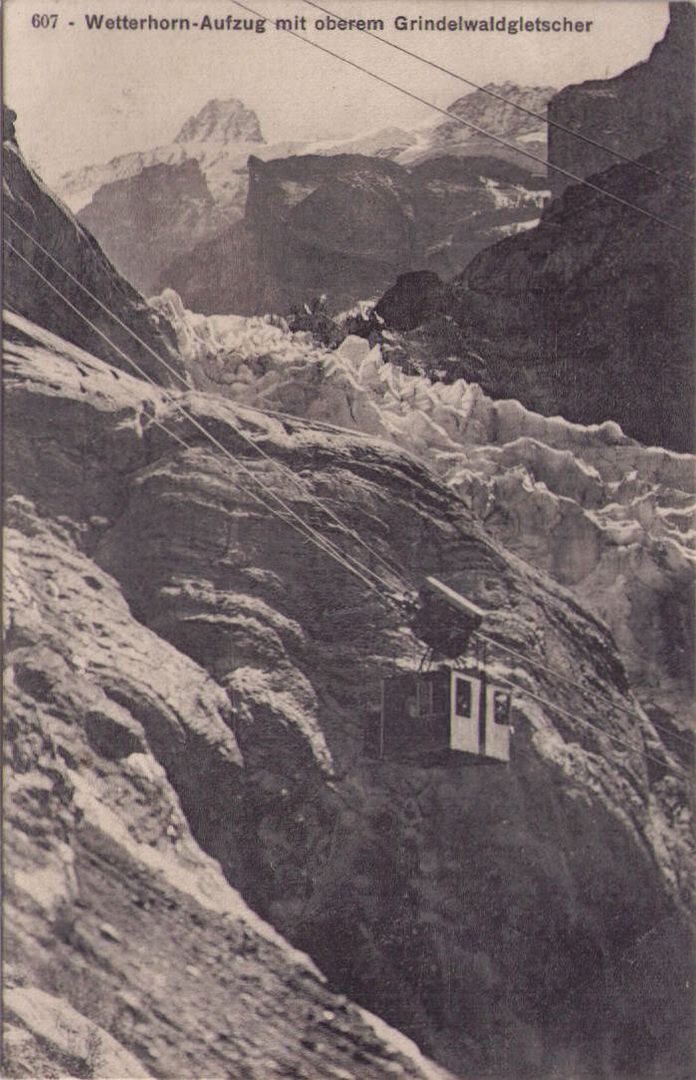
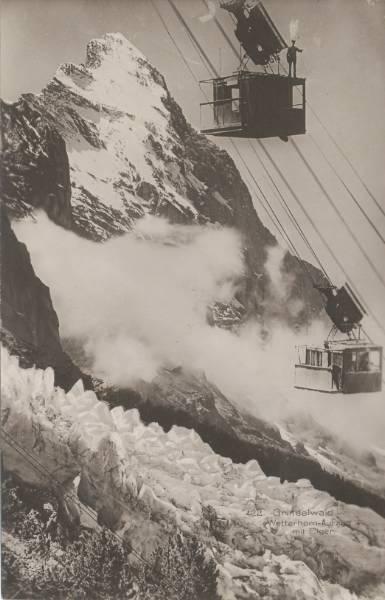




 Hammetschwand Lift (1d)
Hammetschwand Lift (1d)